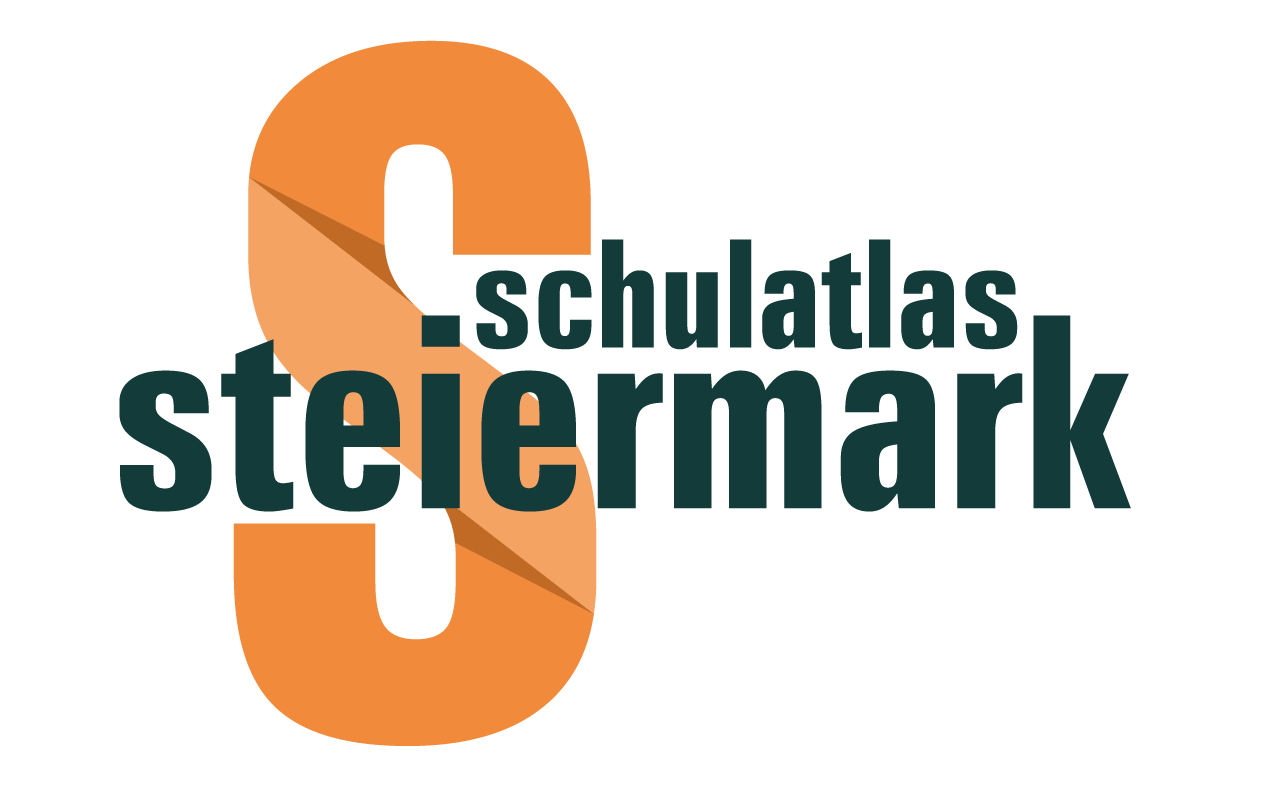5.3 Wasser
Einleitung
In der Nähe fast jeder Schule findet sich zumindest
ein kleiner Bach. Im Alltag kennt man meist nur diesen kleinen Ausschnitt des
Gewässers. Doch wo kommt er her und wo fließt er hin? Ist das Wasser sauber
oder verschmutzt? Was lebt in diesem Gewässer?
Das Kennenlernen von Kleinsttierarten, die im und um
den Bach leben, ist ein „lebendiger“ Weg, um sich dem ökologischen Zustand
eines Gewässers zu nähern. Doch auch die Betrachtung des Ufers von
Fließgewässern, die stoffliche Belastung und andere Parameter machen den
Gesamtzustand eines Fließgewässers aus. Im entsprechenden Unterkapitel wird
dies genau erläutert.
Karten
Arbeitsmaterialien
Didaktik
zum Bereich navigieren
Quellenverzeichnis
Literatur:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2004): Steirischer Gewässergüteatlas 2004, Graz, 69 S.
Österreichisches Zentrum für Umwelterziehung (2000): Handreichung WASSER – Die Wassermappe, Graz, 121 S.
Österreichisches Zentrum für Umwelterziehung (2000): Handreichung WASSER – Unterrichtspraktischer Teil, Graz.
Kartengrundlage:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachstelle GIS
Lehrplan Volksschule, Sachunterricht:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs_7_su_14051.pdf?61ec03
Lehrplan Geographie und Wirtschaftskunde, AHS Unterstufe/NMS:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs9_784.pdf?61ebyf
Lehrplan Geographie und Wirtschaftskunde, AHS Oberstufe:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
Lehrpläne BHS (HLW und Tourismusschulen, HAK, HTL, BAfEP):
https://www.abc.berufsbildendeschulen.at/downloads/?kategorie=24
Lehrplan Biologie und Umweltkunde, AHS Unterstufe/NMS:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/ahs5_779.pdf?61ebyf
Lehrplan Biologie und Umweltkunde, AHS Oberstufe:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568
Autorinnen und Autoren
Text:
Mag. Dieter Pirker (2006)
Lehrplanbezüge:
Mag. Michael Lieb
Mögliche Lernziele:
Mag. Michael Lieb
Kartengestaltung:
Mag.a Edeltraud Posch & Mag. Dieter Pirker (2006)
Arbeitsmaterialien:
Mag. Michael Krobath
Web-Bearbeitung:
Mag.a Bernadette Ebner (2019)
Redaktionelle Bearbeitung:
Nora Schopper BA MSc
Die Bedeutung der Wahrnehmung und Bewertung von Umwelt und die Kenntnisse der Probleme des Umweltschutzes aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Sicht sind allgemeine Bildungs- und Lehraufgaben des GW Unterrichts und in allen Schulstufen zu berücksichtigen. Diese Thematik wird auch schwerpunktmäßig im Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde behandelt. Daher bieten sich diese Materialien besonders für den fächerübergreifenden Unterricht und Projekte an. Es gilt nicht nur ökologische Grundbegriffe zu erarbeiten und zu vertiefen, sondern auch positive wie negative Folgen menschlichen Wirkens hinsichtlich heimischer Gewässer zu analysieren und zu hinterfragen und Umweltprobleme, deren Ursache und Lösungsvorschläge zu erarbeiten bzw. an konkreten Beispielen aufzuzeigen.
Die formulierten Lehrplanbezüge versuchen das jeweilige Thema mit verschiedenen Lehrplaninhalten bzw. Lehrplanforderungen zu verknüpfen. Die möglichen Lernziele, welche mittels des Themas des Schulatlas erreicht werden sollen bzw. können, orientieren sich an den in den Lehrplänen enthaltenen Lerninhalten bzw. -zielen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die alleinige Bearbeitung der Themen und Arbeitsmaterialien des Schulatlas Steiermark die Erreichung der Lernziele nicht garantieren kann. Eine Einbettung dieser in eine umfassendere, sinnvolle sowie zielorientierte Unterrichtsvorbereitung ist dafür notwendig.
Lehrplanbezüge und Lernziele für die „Grundstufe“ sind immer auf den Sachunterricht ausgelegt. Jene der „Sekundarstufe I“ und „Sekundarstufe II“ beziehen sich auf den aktuell gültigen AHS-Lehrplan, wobei erstgenanntes auch die MS umfasst. Bei Lehrplanbezügen und Lernzielen der BHS-Schulformen, sofern nichts zusätzlich in Klammer angemerkt ist, sind folgende Fächer gemeint: HLW und Tourismusschulen = Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft; HAK = Geografie (Wirtschaftsgeografie); HTL= Geografie, Geschichte und Politische Bildung; BAfEP = Geografie und Wirtschaftskunde. Nach den formulierten Lernzielen ist in Klammer der Bezug zum jeweiligen Lehrplan und Unterrichtsfach sowie der jeweilige Anforderungsbereich (AFB I, II, III) angegeben.
Lehrplanforderungen Sekundarstufe I – Geographie und Wirtschaftskunde
1. Klasse:
Ein Blick auf die Erde:
- Erwerben grundlegender Informationen über die Erde mit Globus, Karten, Atlas und Bildern.
2. Klasse:
Gütererzeugung in gewerblichen und industriellen Betrieben:
- Erfassen der Auswirkungen von Betrieben und Produktionsprozessen auf die Umwelt.
3. Klasse:
Lebensraum Österreich:
- Anhand von unterschiedlichen Karten, Luft- und Satellitenbildern die Eigenart österreichischer Landschaften erfassen.
Gestaltung des Lebensraums durch die Menschen:
- Vergleichen unterschiedlicher Standortpotenziale zentraler und peripherer Gebiete an den Beispielen Verkehr, Infrastruktur, Versorgung und Umweltqualität.
4. Klasse:
Gemeinsames Europa – vielfältiges Europa:
- Die Vielfalt Europas – Landschaft, Kultur, Bevölkerung und Wirtschaft– erfassen.
- Informationen über ausgewählte Regionen und Staaten gezielt sammeln und strukturiert auswerten.
- Erkennen, dass manche Gegenwarts- und Zukunftsprobleme nur überregional zu lösen sind, um damit die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit gesamteuropäischen Fragen zu fördern.
Lehrplanforderungen Sekundarstufe I – Biologie und Umweltkunde
2. Klasse:
Ökologie und Umwelt:
- Anhand der Ökosysteme Wald und heimisches Gewässer sind ökologische Grundbegriffe (biologisches Gleichgewicht, Nahrungsbeziehungen, ökologische Nische, Produzent – Konsument – Destruent) zu erarbeiten und zu vertiefen. Positive wie negative Folgen menschlichen Wirkens sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Ökosysteme Wald und heimisches Gewässer zu analysieren und zu hinterfragen. Umweltprobleme, deren Ursache und Lösungsvorschläge sind zu erarbeiten. Umwelt-, Natur- und Biotopschutz sollen an konkreten Beispielen demonstriert werden.
Lehrplanforderungen Sekundarstufe II – Geographie und Wirtschaftskunde
5. Klasse (1. und 2. Semester):
Die soziale, ökonomisch und ökologisch begrenzte Welt.
Geoökosysteme der Erde analysieren.
- Wechselwirkungen von Klima, Relief, Boden, Wasser und Vegetation analysieren.
Nutzungskonflikte an regionalen Beispielen reflektieren.
- Regionale Konflikte über die Verfügbarkeit von knappen Ressourcen (Boden, Wasser, Bodenschätze, usw.) und dahinter stehende politische Interessen erklären.
6. Klasse (3. Semester):
Kompetenzmodul 3:
Vielfalt und Einheit – Das neue Europa.
Außerwert- und Inwertsetzung von Produktionsgebieten beurteilen.
- Abhängigkeit landwirtschaftlicher Nutzung vom Naturraumpotential untersuchen.
- Eignung von Räumen für die Tourismusentwicklung sowie Folgen der Erschließung beurteilen.
7. Klasse (6. Semester):
Kompetenzmodul 6:
Österreich – Raum – Gesellschaft – Wirtschaft.
Naturräumliche Chancen und Risiken erörtern.
- Geoökologische Faktoren und Prozesse erklären.
- Naturräumliche Gegebenheiten als Chance der Regionalentwicklung erkennen.
- Naturräumliche sowie soziale Gegebenheiten und Prozesse als Ursachen ökologischer Probleme erörtern.
Lehrplanforderungen BHS
HAK:
I. Jahrgang (1. und 2. Semester):
Geoökologische Wirkungsgefüge und wirtschaftliche Auswirkungen:
- Wechselspiel zwischen Klima und Vegetation, wirtschaftliche Nutzungen und ihre Auswirkungen (Konfliktfelder und Konfliktbewältigung bezüglich Umwelt, Bodenschätze, Ressourcenverteilung).
II. Jahrgang (4. Semester):
Kompetenzmodul 4:
Wirtschafts- und Lebensraum Österreich:
- Naturräumliche Nutzungspotenziale.
HLW und Tourismusschulen:
III. Jahrgang (5. Semester):
Kompetenzmodul 5:
Lehrstoff:
- Nutzung von Naturräumen.
V. Jahrgang (10. Semester):
Kompetenzmodul 9:
Österreich:
- Naturräumliche Voraussetzungen und Nutzungen.
HTL:
I. Jahrgang:
- Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen; Ressourcenknappheit und Tragfähigkeit der Erde; Nachhaltigkeit in der Raumnutzung; Nutzungskonflikte; Lebensraum Österreich.
BAfEP:
I. Jahrgang (1. und 2. Semester):
Bereich „Naturräume“:
- Landschaftsökologische Zonen, wirtschaftliche Nutzung.
Die Schülerinnen und Schüler können…
- Auswirkungen von Betrieben und damit verbundenen Produktionsprozessen auf die Wasserqualität von Flüssen oder Seen beschreiben. (Sekundarstufe I – Geographie und Wirtschaftskunde / AFB I)
- anhand unterschiedlicher Karten die Eigenart steirischer Landschaften mit Fokus auf Gewässer erfassen. (Sekundarstufe I – Geographie und Wirtschaftskunde)
- die Gewässergüte als Gegenwarts- und Zukunftsproblem beschreiben, welches nur überregional zu lösen ist. (Sekundarstufe I – Geographie und Wirtschaftskunde / AFB I)
- negative Folgen menschlichen Wirkens hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Ökosystem heimisches Gewässer analysieren. (Sekundarstufe I – Biologie und Umweltkunde / AFB II)
- regionale Konflikte über die Verfügbarkeit von knappen Ressourcen, exemplarisch anhand von Gewässern, in Verbindung mit dahinter stehenden politischen Interessen erklären. (Sekundarstufe II – Geographie und Wirtschaftskunde / AFB II)
- die Abhängigkeit landwirtschaftlicher Nutzung vom Naturraumpotential Wasser exemplarisch anhand der steirischen Gewässergüte untersuchen. (Sekundarstufe II – Geographie und Wirtschaftskunde / AFB II)
- naturräumliche Gegebenheiten wie Flüsse als Chance der Regionalentwicklung erkennen und analysieren. (Sekundarstufe II – Geographie und Wirtschaftskunde / AFB II)
- naturräumliche Gegebenheiten Österreichs exemplarisch anhand der Eigenheiten der steirischen Gewässer und deren Qualität beschreiben. (HLW und Tourismusschulen / AFB I)
- naturräumliche Nutzungspotenziale exemplarisch anhand der steirischen Flüsse analysieren. (HAK / AFB II)
- Nutzungskonflikte und Ökokrisen exemplarisch anhand der steirischen Gewässer erkennen und erklären. (HTL / AFB II)
- Nutzungen und Gefährdungen natürlicher Lebensräume, in diesem Fall Gewässer, durch den Menschen analysieren. (BAfEP / AFB II)
Gewässerreinhaltung ist ein zentrales Thema im Umweltschutzbereich. Erhebung, Analyse, Darstellung und Interpretation der Fließgewässergüte betreffen nicht nur das Schulfach Geographie und Wirtschaftskunde sondern auch Biologie (Zeigerorganismen), Chemie (Inhaltsstoffe), Physik (Fließdynamik) und Geschichte (Wirtschaftsgeschichte). Daher ist ein fächerübergreifender Ansatz wünschenswert um die komplexen Zusammenhänge vermitteln zu können.
Da die in der Steiermark angewandte Methodik und Systematik für Gewässeruntersuchungen im gesamten europäischen Raum Anwendung findet, lässt sie sich am Beispiel unseres Bundeslandes als ein allgemein anerkanntes Umweltschutzinstrument vermitteln.